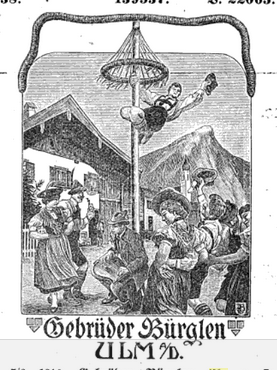Tabakwaren, Pfeifenmacher und Zunderfabriken
Inzwischen vollkommen aus dem städtischen Wirtschaftleben Ulms verschwunden ist die Tabakindustrie.
Seinen weit zurückreichenden Ursprung hat der Tabakkonsum bei den Einwohnern in den Hauptanbaugebieten in Süd- und Nordamerika. Nach der Entdeckung des Kontinents durch die spanischen Eroberer übernahmen die Matrosen der Handelsschiffe bald die Sitte des Rauchens. Der europäischen Bevölkerung bekannt wurde das Genuss- und Rauschmittel erst später durch Soldaten während des Dreißigjährigen Krieges.
Traditionell wurde Tabak entweder geschnupft oder in der Pfeife geraucht. Kautabak war lange unter den Seeleuten beliebt und besonders in Amerika verbreitet. In Süddeutschland wurde er nur dann vermehrt konsumiert, wenn das Tabakrauchen wieder einmal verboten war.
Kubanische Zigarren waren zwar schon 18. Jahrhundert in den nordamerikanischen Kolonialgebieten bekannt, in Deutschland konnten sie sich erst im Umfeld des Vormärz und der Revolution 1848/49 durchsetzen.
Die Zigarette in der heutigen Form wurde um 1850 erfunden. Das Gebäude der ersten deutschen Zigarettenfabrik, die Yenidze, steht heute noch und gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Dresden.
Um Tabak rauchen zu können muss er zum Brennen gebracht werden. Die Geschichte des Feuer erzeugens beginnt daher mit dem Tag, als es dem Menschen gelang selbst kontrolliert Feuer zu entzünden. Eine anfangs noch gefährliche Frühform des Feuerzeugs wurde 1823 von dem deutschen Chemiker Johannes Wolfgang Döbereiner erfunden. Taschenfeuerzeuge im heutigen Sinn gibt es erst seit der Entwicklung der Cereisen-Zündung durch Carl Auer von Welsbach.
Zuverlässige und ungiftige Zündhölzer sind auch erst in dieser Zeit (um 1850) entwickelt worden. Bis dahin verwendete man Zunder, das auch in Ulmer Fabriken hergestellt wurde.
Seinen weit zurückreichenden Ursprung hat der Tabakkonsum bei den Einwohnern in den Hauptanbaugebieten in Süd- und Nordamerika. Nach der Entdeckung des Kontinents durch die spanischen Eroberer übernahmen die Matrosen der Handelsschiffe bald die Sitte des Rauchens. Der europäischen Bevölkerung bekannt wurde das Genuss- und Rauschmittel erst später durch Soldaten während des Dreißigjährigen Krieges.
Traditionell wurde Tabak entweder geschnupft oder in der Pfeife geraucht. Kautabak war lange unter den Seeleuten beliebt und besonders in Amerika verbreitet. In Süddeutschland wurde er nur dann vermehrt konsumiert, wenn das Tabakrauchen wieder einmal verboten war.
Kubanische Zigarren waren zwar schon 18. Jahrhundert in den nordamerikanischen Kolonialgebieten bekannt, in Deutschland konnten sie sich erst im Umfeld des Vormärz und der Revolution 1848/49 durchsetzen.
Die Zigarette in der heutigen Form wurde um 1850 erfunden. Das Gebäude der ersten deutschen Zigarettenfabrik, die Yenidze, steht heute noch und gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Dresden.
Um Tabak rauchen zu können muss er zum Brennen gebracht werden. Die Geschichte des Feuer erzeugens beginnt daher mit dem Tag, als es dem Menschen gelang selbst kontrolliert Feuer zu entzünden. Eine anfangs noch gefährliche Frühform des Feuerzeugs wurde 1823 von dem deutschen Chemiker Johannes Wolfgang Döbereiner erfunden. Taschenfeuerzeuge im heutigen Sinn gibt es erst seit der Entwicklung der Cereisen-Zündung durch Carl Auer von Welsbach.
Zuverlässige und ungiftige Zündhölzer sind auch erst in dieser Zeit (um 1850) entwickelt worden. Bis dahin verwendete man Zunder, das auch in Ulmer Fabriken hergestellt wurde.
 Tabak-Fabriken
Tabak-Fabriken
Firmenliste Tabakwarenfabriken
 Pfeifenmacher
Pfeifenmacher
Firmenliste Pfeifenmacher
 Zundelmacher
Zundelmacher
Firmenliste Zunder- und Zündholzfabriken
Tipp:
Wenn die Karten am Ende mit ... gekennzeichnet sind steht mehr zu den einzelnen Namen und Schlagworten auf der Rückseite der Karten. Zum Wenden bitte mit der Maus über die Karte fahren.
Mit gekennzeichnete Anzeigen können durch Anklicken als Vollbild dargestellt werden.
Wenn die Karten am Ende mit ... gekennzeichnet sind steht mehr zu den einzelnen Namen und Schlagworten auf der Rückseite der Karten. Zum Wenden bitte mit der Maus über die Karte fahren.
Mit gekennzeichnete Anzeigen können durch Anklicken als Vollbild dargestellt werden.
Quellen:
1: Wolfgang Merkle - Gewerbe und Handel der Stadt Ulm am Übergang der Reichsstadt an Bayern im Jahre 1802 und an das Königreich Württemberg im Jahre 1810
2: Hans Eugen Specker - Ulm im 19.Jahrhundert, S. 113
3: Albert Haug - "Tabak-Mühlen" - Anfänge und Geschichte der Ulmer Tabakindustrie, in: Ulm und Oberschwaben Bd. 53/54, Stadtarchiv Ulm 2007
alle anderen Daten: Stadtarchiv Ulm, Adressbuch 1812 - 1939
1: Wolfgang Merkle - Gewerbe und Handel der Stadt Ulm am Übergang der Reichsstadt an Bayern im Jahre 1802 und an das Königreich Württemberg im Jahre 1810
2: Hans Eugen Specker - Ulm im 19.Jahrhundert, S. 113
3: Albert Haug - "Tabak-Mühlen" - Anfänge und Geschichte der Ulmer Tabakindustrie, in: Ulm und Oberschwaben Bd. 53/54, Stadtarchiv Ulm 2007
alle anderen Daten: Stadtarchiv Ulm, Adressbuch 1812 - 1939
-- Tabak --
- Mehr über die Tabakindustrie in Ulm in den -» Ulmer Geschichten im Netz - Tabakindustrie.
- Über die Geschichte der Tabakindustrie informiert auch ein Vortrag, den Prof. Dr. Alber Haug in Rahmen eines Abend der Technikgeschichte gehalten hat. Das Video dazu kann -» hier ¹ über youtube angesehen werden.
- Sehr informativ ist die Webseite -» "Mein kleiner Rauchsalon [mf]" von Matthias Flachmann. Dort finden sich neben Informationen zur Firma Gebr. Schäfer auch andere interessante Hinweise zur überregionalen Tabakindustrie.
-- Ulmer Maserholz-Pfeifen --
- Eine kurzgefasste allgemeine -» Geschichte der Tabakspfeifen
-
Rainer Immensack - -» Ulmer Maserholzpfeifen (pipedia.org, Stand Jan. 2023)
-
Eine Monografie zur Herstellung von Tabakspfeifen aus dem Jahr 1830, gedruckt bei Ebner in Ulm:
-» Die Fabrikation der Rauchtabackpfeifen aus Holzmasern, Meerschaum, Thon- und Türkenerde, und der Chemischen Feuerzeuge
Nebst Unterricht beim Beschlagen, Einkauf, Anrauchen, Behandeln etc. der Pfeifenköpfe. So wie auch Diätetik und Vorsichtsregeln für Raucher, Schnupfer und Biertrinker
- weitere Literatur:
Anton Manger - Die berühmten Ulmer Maserholzpfeifen, 1998, ISBN:3-9802436-4-8
Friedrich Becker - Blauer Dunst aus Ulmer Pfeifen, in: Ulmer Forum (1983/84)
-- Zunder und Zündholz --
- Mehr zur Geschichte von Zunder und Feuerschwamm bei -» Frank Gnegel
-- Ulmer Maserholz-Pfeifen --
-» Die Fabrikation der Rauchtabackpfeifen aus Holzmasern, Meerschaum, Thon- und Türkenerde, und der Chemischen Feuerzeuge
Nebst Unterricht beim Beschlagen, Einkauf, Anrauchen, Behandeln etc. der Pfeifenköpfe. So wie auch Diätetik und Vorsichtsregeln für Raucher, Schnupfer und Biertrinker
Anton Manger - Die berühmten Ulmer Maserholzpfeifen, 1998, ISBN:3-9802436-4-8
Friedrich Becker - Blauer Dunst aus Ulmer Pfeifen, in: Ulmer Forum (1983/84)
-- Zunder und Zündholz --
¹: Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube
übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen
haben.
letzte Aktuallisierung Seite u. Links: Jan. 2023